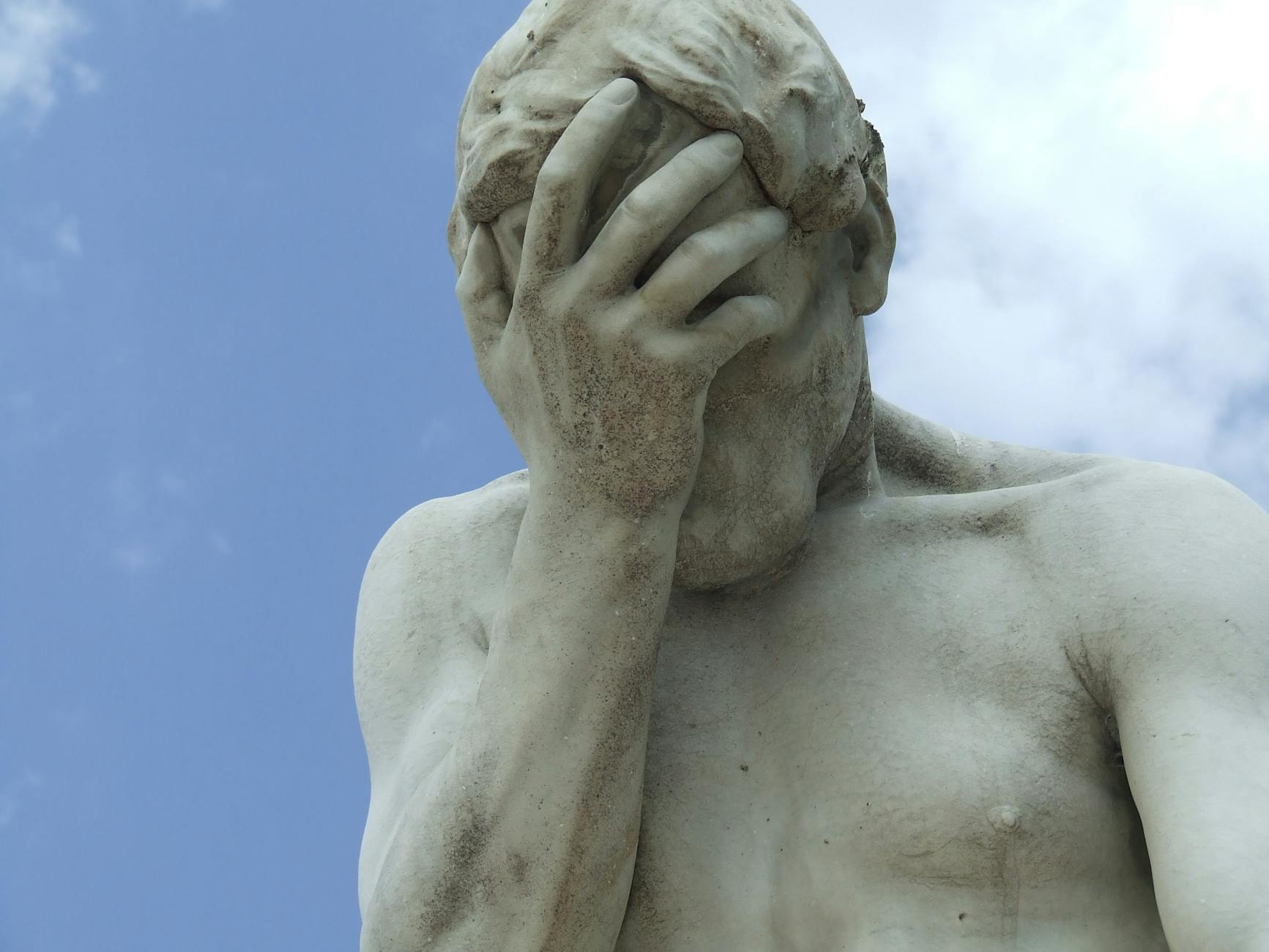causasportnews / Nr. 1105/01/2024, 30. Januar 2024

(causasportnews / red. / 30. Januar 2024) Wer derzeit die alpinen Skirennen verfolgt, wähnt sich eher in der TV-Serie «Der Bergdoktor» als an Sportveranstaltungen. Praktisch in jedem Speed-Wettbewerb müssen die Rennen der Frauen und Männer unterbrochen werden, damit der Rettungs-Helikopter mehrheitlich schwer verletzte Fahrerinnen und Fahrer ins nächstgelegene Spital fliegen kann. Die teils furchterregenden Stürze nehmen meist ein schlimmes Ende – nicht wie jeweils das Finale in der TV-Serie mit Hans Sigl. Die Realität auf den Rennpisten und was sich dort zuträgt, ist eben mehr als nur eine Gefühlswelt mit medizinischem Touch am «Wilden Kaiser», sondern oft eine Kombination von Pech, Dramen und Schicksalsschlägen an den Austragungsorten im Rahmen des Ski-Weltcups.
Was ist nur los auf den Speed-Strecken im alpinen Skirennsport? Bilden die schlimmen Stürze und die verheerenden Verletzungsfolgen eine Kumulation von Zufällen? Oder handelt es sich um eine unglaubliche und rational nicht nachvollziehbare Pech-Serie? Über die Ursachen dieser Vorkommnisse wird im Moment gemutmasst und gerätselt. Die Rede ist bei den Analysen der teils gravierenden Unfälle von gehäuften, individuellen Fahrfehlern, von Überforderungen der Skiläuferinnen und -läufer bei diesen Geschwindigkeitsexzessen und von objektiven Gegebenheiten, die sind, aber nicht sein müssten. Da sich die Unfälle ausschliesslich in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G ereignen, wird auch die entsprechende Sinnfrage gestellt. Es werden zudem Massnahmen diskutiert, etwa massive Tempo-Verringerungen und die Implementierung von noch mehr Sicherheits-Vorkehren. Für viele Betrachter sind die Rennen, in denen teils weit mehr als 100 Stunden-Kilometer erreicht werden, eine sinnlose Raserei geworden. Dass Stürze in diesen Geschwindigkeitsbereichen in der Regel grosse Verletzungsgefahren implizieren, ist evident. Die Unfälle sind sich wiederholende Tatsachen, die Einwilligungen der Fahrerinnen und Fahrer in das vorhandene Risiko hat nur haftungs- und versicherungsrechtliche Bedeutung.
Der Zufall oder was auch immer will es, dass sich in dieser Phase grausamer Stürze, von welcher auch Top-Fahrerinnen und -Fahrer, wie Aleksander Kilde oder Mikaela Shiffrin direkt betroffen sind, der Todestag einer erfolgreichen Rennfahrerin zum 30. Mal jährt. Am 29. Januar 1994 verstarb die Österreicherin Ulrike Maier beim Abfahrtslauf in Garmisch-Partenkirchen unter tragischen Umständen. Der Verlobte mit der gemeinsamen Tochter mussten sich das Drama um die 27jährige Partnerin und Mutter vor dem Fernsehen anschauen. Die «Unfall-Causa Ulrike Maier» wirkt bis heute nach. Die Tragödie führte zudem zu einem strafrechtlichen Nachspiel. Die beiden FIS-Renndirektoren Jan Tischhauser und Kurt Hoch mussten sich zwei Jahre nach dem Todessturz der Fahrerin vor einem Münchner Gericht wegen fahrlässiger Tötung verantworten; das Verfahren endete mit einem Vergleich. Die beiden Beschuldigten bezahlten je 10’000 Mark an die Bergwacht.- Nicht nur der Skiunfall von Ulrike Maier bleibt in trauriger Erinnerung. Immer wieder schlug danach das Schicksal im alpinen Ski-Rennsport brutal zu. In der aktuellen Unfall-Häufung blieb der Skisport wenigstens vom Schlimmsten verschont. Aber die Ereignisse lassen mit Blick auf die Zukunft Extremes befürchten. Wahrscheinlich können Tragödien in den Speed-Disziplinen nur verhindert werden, falls die Geschwindigkeiten beschränkt werden; schneller, höher, weiter – zumindest schneller muss es nicht immer sein. Spektakel ist auch anderweitig möglich. Aber auch in diesem Zusammenhang bleiben Worte von Ulrike Maier einige Zeit vor ihrem Todessturz haften. Sie sagte einmal in einem Interview, auf die Gefahren im Skisport angesprochen: «Wenn es vorbestimmt ist, dann passiert es. Dem Schicksal kann man sowieso nicht ausweichen.». Auch dreissig Jahre nach ihrem Tod wirkt diese Aussage nach.