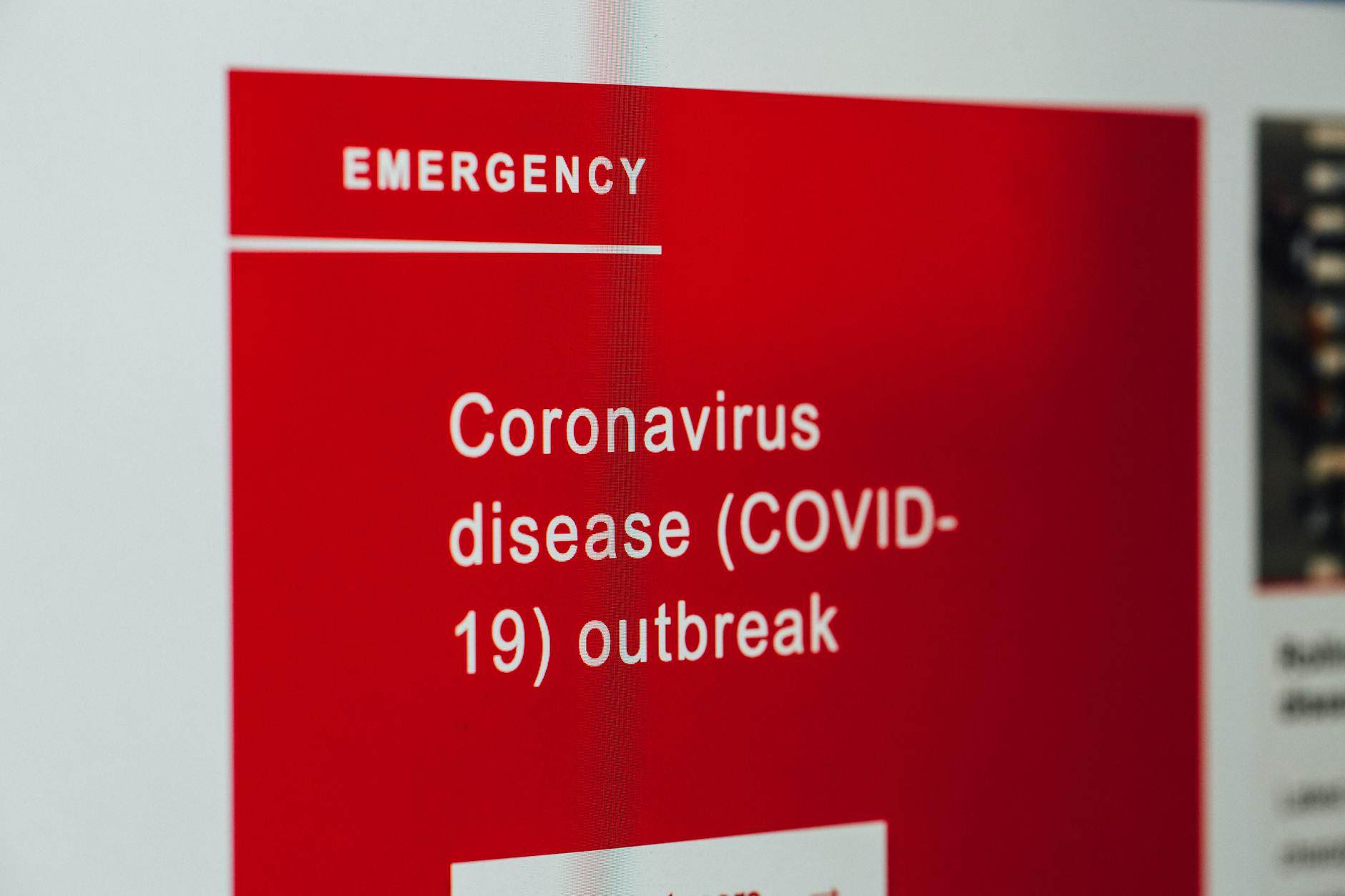causasportnews / Nr. 1156/06/2024, 30. Juni 2024

(causasportnews / red. / 30. Juni 2024) Darüber, dass Schach (k)ein Sport sei, wird schon lange nicht mehr ernsthaft diskutiert. Dass die Schachwelt zudem ein spezielles Universum abgibt, ist auch kein Gesprächs-Thema mehr. Spitzen-Schachspieler(innen) bewegen sich in einer besonderen Welt; die Akteure sind im Bereich von Genialität und Wahnsinn einzuordnen. Seit Jahren beherrscht und prägt der 33jährige Magnus Carlsen den Welt-Schachsport. Von 2013 bis 2023 war er Weltmeister (auf ihn folgte der Chinese Ding Liren), aktuell wird er als Weltmeister im Schnell- und Blitzschach geführt. Der Mann mit einem Intelligenzquotienten (IQ) von 190 (Albert Einstein und Stephen Hawking wird ein IQ von 160 nachgesagt) gilt im Schach als «homme à battre» (der Mann, den es zu schlagen gilt).
Am 4. September 2022 fand Magnus Carlsen im US-amerikanischen Grossmeister Hans Moke Niemann einen Bezwinger. Völlig überraschend schlug der soeben 21 Jahre alt gewordene, gebürtige Däne den Maestro dieser Disziplin, eben Magnus Carlsen. Im Saint Louis Chess Club spielte der etwas ungehobelte Aussenseiter Hans Niemann die brillanteste Partie seiner noch jungen Schach-Karriere und demontierte den zwölf Jahre älteren Weltmeister sensationell und spektakulär. Der Amerikaner kostete seine geistige Überlegenheit, die er an jenem Sonntag im Saint Louis Chess Club an den Tat legte, aus; wohl etwas provokativ zu stark. Die Öffentlichkeit war erstaunt und bewunderte das noch sehr junge Schach-Genie, Magnus Carlsen erholte sich in der Folge nicht mehr von diesem Schock und sprach bald einmal, an die Adresse von Hans Niemann gerichtet, von Unregelmässigkeiten. Was nicht sein kann, durfte nicht sein. Bald machten Manipulations- und Betrugsgerüchte die Runde. Es entstand der Eindruck, Magnus Carlsen sei ein schlechter Verlierer. Das Nachspiel der Partie vom 4. September 2022 verlagerte sich in die Gerichtssäle. Ein Betrug konnte Hans Niemann aufgrund der Verdächtigungen von Magnus Carlsen niemand beweisbar vorwerfen, weshalb die juristische Auseinandersetzung bald ein Ende fand. Signifikant war in dieser Hinsicht, dass der im Herbst 2022 unbeschwert aufspielende Hans Niemann an der auch pekuniär bedeutenden «Institution Magnus Carlsen» kratzte und damit auch das ganze Schach-Establishment gegen sich aufbrachte. Der Maestro wird nun, nachdem sich die Betrugsvorwürfe gegen den 21jährigen Newcomer, die sich übrigens nicht nur auf diese einzelne Partie bezogen, nicht erhärten liessen, auch wieder gegen Hans Niemann antreten; das 64 Felder-Trauma wird er zweifelsfrei nicht so schnell loswerden. Die ungestüme Schach-Jugend, verkörpert durch Hans Niemann, und das etablierte, universelle Schach-Milieu von Magnus Carlsen haben die Auswirkungen der krachenden Niederlage von Magnus Carlsen 4. September 2022 wohl auf diese Weise am sinnvollsten für beendet erklärt. Was wäre wohl, wenn Hans Niemann Magnus Carlsen (nochmals) besiegen würde?